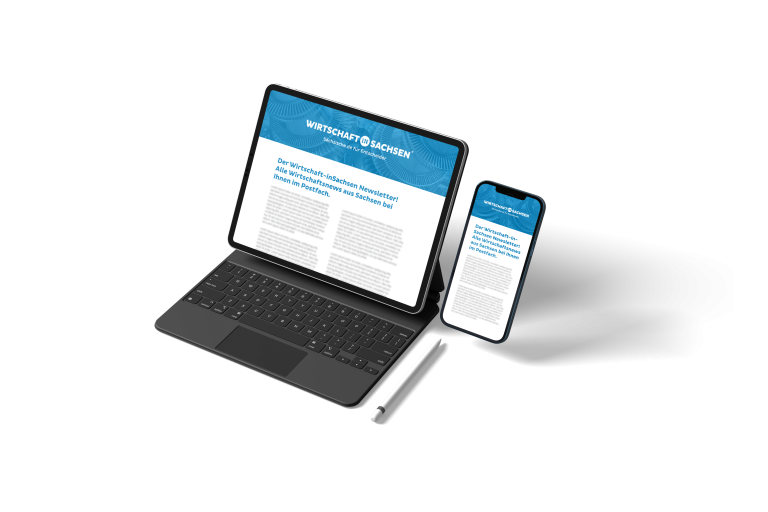Dresden. Fotografieren verboten! Darauf weist unmissverständlich ein rot markiertes Piktogramm an der Tür hin, die in eine kleine Werkhalle am Dresdner Stadtrand führt. Als die Smartphones der Besucher in den Hosentaschen verschwunden sind, schließt Christian Köhler die Metalltür auf. Wie und was genau hier produziert wird, ist Betriebsgeheimnis. Das könnte demnächst sogar von nationaler Bedeutung sein, jedenfalls erträumen sich das die Macher des Startup-Unternehmens Germanium Skies GmbH.
Mitten in ihrer Werkstatt im Dresdner Nordosten steht eine etwa drei Meter hohe Konstruktion aus weiß lackierten Stahlprofilen. Die tragen auf einem Ring mit mehreren Metern Durchmesser Dutzende, zigarettenschachtelgroße, elektronische und mechanische Geräte. Das ist die wichtigste Maschine, mit der die Firma den großen Durchbruch schaffen will, die erst vor Kurzem gegründet wurde.
Mit einer selbst entwickelten Technologie werden hier Leichtbauelemente aus Carbon hergestellt. Köhler, ein drahtiger Typ mit hellem Hemd, steht darunter und sagt stolz: „In wenigen Wochen können wir mit der Serienproduktion beginnen.“ Sein eher raues Gesicht mit dunklem Dreitagebart hellt sich auf. Die Vorfreude ist offenbar groß.
Der Ingenieur ist Experte für Leichtbau und zusammen mit Geschäftsführer Jörn Kiele und Michael Dreßler Gesellschafter des Unternehmens. Aktuell produzieren sie für einen Sportartikelhersteller kleine Carbon-Teile. Sie sind sehr leicht und trotzdem extrem belastbar.

Quelle: SZ/Veit Hengst
Dann präsentiert Kiele, was zum Prunkstück des Startup-Unternehmens werden soll. „Das ist der Demonstrator unseres Flugsystems“, erklärt der 42-Jährige. Es ist eine Drohne mit zehn Armen. Acht sind mit Rotoren besetzt, zwei mit schwenkbaren Flügeln. In der Mitte hängt eine Art Kugel. Die ist aerodynamisch geformt und stellt das Transportmodul dar.
Für Personentransport geeignet
Es handele sich um ein besonders effektives Flugsystem, das es in dieser Kombination noch nicht gibt. Man habe dafür ein Portfolio an internationalen Patenten aufgebaut, frohlockt Kiele. Jetzt braucht es nur noch interessierte Investoren.
„Wir verbinden die Technik von flugzeugähnlichen Drohnen mit der herkömmlicher senkrechtstartender Drohnen“, erklärt Kiele, der in Dresden Luft- und Raumfahrttechnik studiert hat. Etwa 30 Kilogramm kann der Demonstrator transportieren. Gesehen haben das bislang nur eine Handvoll Menschen. Die Tests waren geheim.
Der Clou: Das von ihnen entwickelte Fluggerät soll in einer Größe in Serie gehen, das mit 20 Rotoren ausgerüstet bis zu 300 Kilogramm Nutzlast transportieren kann und sogar für den Personentransport geeignet wäre. Das Transportmodul kann vom Flugmodul je nach Bedarf getrennt werden.
Bedarf an Drohnen gab es bis vor dem Krieg in der Ukraine nur sporadisch. Im zivilen Sektor wären das Paketdienstleister oder innovative Taxiunternehmen der Zukunft. Das System könnte auch Alternative zu Seilbahnen sein, deren Bau erheblich in die Landschaft eingreift.
Bundeswehr fordert Tempo
Seit der Ankündigung von CDU/CSU und SPD im militärischen Sektor das Geld sprudeln zu lassen, nimmt das Dresdner Startup auch diese Option ernsthaft in die Entwicklungspläne auf. Mit der neuartigen Drohne könnten etwa Verletzte im Einsatz gerettet oder Waffen transportiert werden.
Ist die Bundeswehr schon auf die Dresdner aufmerksam geworden? Das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) in Koblenz will sich dazu auf Nachfrage nicht äußern. Einfach mal beim Amt für Beschaffung anzurufen und sein Produkt anzubieten, „das wird wohl nicht so erfolgreich sein“, sagt Köhler.
Dem widerspricht allerdings das BAAINBw. Bei Forschungs- und Technologievorhaben sei es gar nicht so selten, dass Unternehmen ihre Innovationen direkt beim Bundesamt vorstellen. Die Beschaffung müsse sich am Grundsatz der Wirtschaftlichkeit orientieren. „Oberste Priorität hat dabei der Faktor Zeit“, erklärt eine Sprecherin.
Lehmanns einsamer Kampf für Sachsen
Welche Hemmnisse es in Sachsen gibt, mit Innovationen an den Markt zu kommen, zeigt eine kürzlich veröffentlichte . Mehr als 1.000 Unternehmen hatten sich daran beteiligt. Am erfolgversprechendsten sind demnach geförderte Projekte. Gleich danach werden informelle Kontakte und persönlicher Austausch genannt. Doch mit wem eigentlich? Wer ist für militärische Angelegenheiten in Sachsen Ansprechpartner?
Im Verteidigungsausschuss des alten Bundestags saß auch die Dresdnerin Merle Spellerberg. Die Grüne arbeitete allerdings nicht an Aufrüstung, sondern engagierte sich im Unterausschuss Abrüstung. Zur Bundestagswahl im Februar schaffte sie es nicht erneut ins Parlament.
Partner zu vernetzen, das hat sich der CDU-Bundestagsabgeordnete Jens Lehmann zur Aufgabe gemacht. Der Olympiasieger im Bahnradsport aus Leipzig gehört ebenfalls seit Jahren dem Verteidigungsausschuss an. Deshalb hatten sich Kiele und seine Mitstreiter an ihn gewandt.

Quelle: Wolfgang Sens
In seinem Wahlkreisbüro in Leipzig-Engelsdorf stehen zahlreiche Erinnerungsstücke an Begegnungen mit Bundeswehrangehörigen. Neben einem Mini-Taurus-Modell liegt die Gedenkmedaille „Air Defender 2023“. Das war die größte Verlegeübung der Luftstreitkräfte der Nato. An der Wand hängen mehrere Fotos, wo Lehmann militärische Kleidung trägt.
Jetzt sitzt er in einem weißen Pullover am Tisch und erzählt, wie schwer es ist, etwas von den Milliarden für die Bundeswehr nach Sachsen zu lenken. Die Rüstungsunternehmen seien tatsächlich aufgeschlossen dafür, erklärt Lehmann. Doch wer wolle in einer Region investieren, wo Investoren beschimpft oder verachtet werden?
Lehmann hatte beispielsweise den Großkonzern Rheinmetall gewinnen wollen, . Rund 500 gut bezahlte Arbeitsplätze sollten entstehen. Die Stadtgesellschaft lehnte dankend ab, vom Bürgermeister bis zu Lokalpolitikern von Linken und AfD. „Das war ein Dämpfer”, sagt Lehmann. Nun würden andere Standorte ausgebaut. Einen hat Rheinmetall in Ungarn. Die Orban-Regierung umschwärmt die Deutschen geradezu, dort weiter zu investieren.
Arbeitsplätze für Facharbeiter
Lehmann könne verstehen, dass es unterschiedliche Auffassungen dazu gibt, wie viel Geld in militärische Ausstattung gegeben wird. Nachdem die Entscheidung mehrheitlich gefallen ist, Milliarden dafür auszugeben, sollte man diese Chance für Sachsen nicht ungenutzt lassen.
In Görlitz übernimmt das Rüstungsunternehmen KNDS das Alstom-Werk. . Dagegen gab es bereits im Februar Proteste von Pazifisten. Jetzt haben Klimaaktivisten zu Aktionstagen gegen die Produktion von Militärtechnik aufgerufen. Man solle statt Panzern lieber weiter Waggons bauen.
„Die Option steht aber gar nicht“, sagt Lehmann. Es gehe einzig darum, ob in Görlitz Teile für Militärtechnik gebaut würden oder gar nichts mehr. Der CDU-Politiker habe die Entwicklung zwei Jahre mit begleitet. Aus seiner Sicht würde die Ansiedlung eines Rüstungsunternehmens mehr Strukturentwicklung und Arbeitsplätze für Facharbeiter bringen als ein Fraunhofer-Institut.
Das Geld aus dem ersten Sondervermögen für die Bundeswehr ging an Sachsen fast komplett vorbei. Lediglich der geplante Ausbau des Standortes Holzdorf in Brandenburg strahle bis nach Sachsen aus. Der Freistaat müsse mehr um Standorte kämpfen, erklärt Lehmann.
Im Land der Ingenieure
Der Bundestagsabgeordnete stand auch schon in der Germanium-Werkstatt in Dresden. Hier wird es jetzt laut. Mit einem Trennschleifer bearbeitet einer der zehn Beschäftigten ein Bauteil. In einer Ecke stehen mehrere Kisten mit Spulen. Darauf sind dünne Fäden mit Kohlenstofffasern gewickelt. „Das ist der Grundstoff für unsere Leichtbauteile“, erklärt Köhler. Vergleichbar vielleicht mit einem riesigen Webstuhl werden die Fasern verflochten und in Form gebracht.
Was bei Germanium Skies passiert, wirkt wie das Paradebeispiel eines Landes der Ingenieure. Kiele, Köhler und Dreßler kennen sich schon vom Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik an der TU Dresden. Sie empfinden es als Beleidigung, würde man es als „basteln” bezeichnen, was sie tun. Seit Jahren beschäftigen sie sich mit Fertigungsprozessen für Carbonteile. Sie entwickelten beispielsweise die Bewehrungsstäbe, mit denen eine Brücke aus Carbonbeton bei Wurschen im Landkreis Bautzen errichtet wurde. Die ist ohne Bewehrung aus Stahl rostfrei.
Das würde auch für die zivile Nutzung erhebliche Fortschritte bringen – Jörg Kiele, Geschäftsführer Germanium SKIES
Stolz präsentiert die Holding, zu der Germanium Skies gehört, auf ihrer Homepage Referenzen. Dazu gehören Vollcarbonräder sowie ein Elektroauto im Faserverbundleichtbau, das die heutigen Germanium-Chefs mit entwickelt hatten. „Das ist voll fahrfähig und wurde zur Automobilmesse in Frankfurt vorgestellt“, erklärt Kiele. Um es zur Marktreife zu führen, wäre ein starker Investor nötig gewesen. Dabei seien zahlreiche Einzelthemen entstanden, die weiterentwickelt wurden.
Allerdings ist das derzeit noch teurer, weil es bei Carbon keine industrielle Produktion wie etwa beim Stahl gibt. Die neue Anlage bei Dresden soll immerhin eine kostengünstige Serienproduktion möglich machen. Unbegrenzte Investitionssummen, wie sie jetzt von Friedrich Merz für die Ausrüstung der Bundeswehr in Aussicht gestellt wurden, könnten den Sprung zur industriellen Produktion erheblich beschleunigen.
„Das würde in der Folge auch für die zivile Nutzung erhebliche Fortschritte bringen“, sagt Kiele. Das größte Ziel wäre, längerfristig vom Entwickler zum Hersteller zu werden.
Hat das Unternehmen keine Scheu?
In Sachsen gibt es rund 180 Firmen, die als Zulieferer Verträge mit dem Beschaffungsamt der Bundeswehr haben. Das reicht von Uniformteilen bis zu Granathülsen. Viele Hersteller von Rüstungsprodukten scheuen die Öffentlichkeit. Für manche Sachsen gilt Rüstungsproduktion als verpönt, statt als attraktiver Arbeitgeber mit überdurchschnittlichen Löhnen.
Startups wie die Germanium Skies können sich so eine Zurückhaltung nicht leisten. Sie müssen auf sich aufmerksam machen, um sich gegen etablierte Rüstungsunternehmen aus den alten Bundesländern zu behaupten, die bestens vernetzt sind. „Wir machen es den alten Bundesländern ansonsten zu leicht“, erklärt Lehmann.
SZ